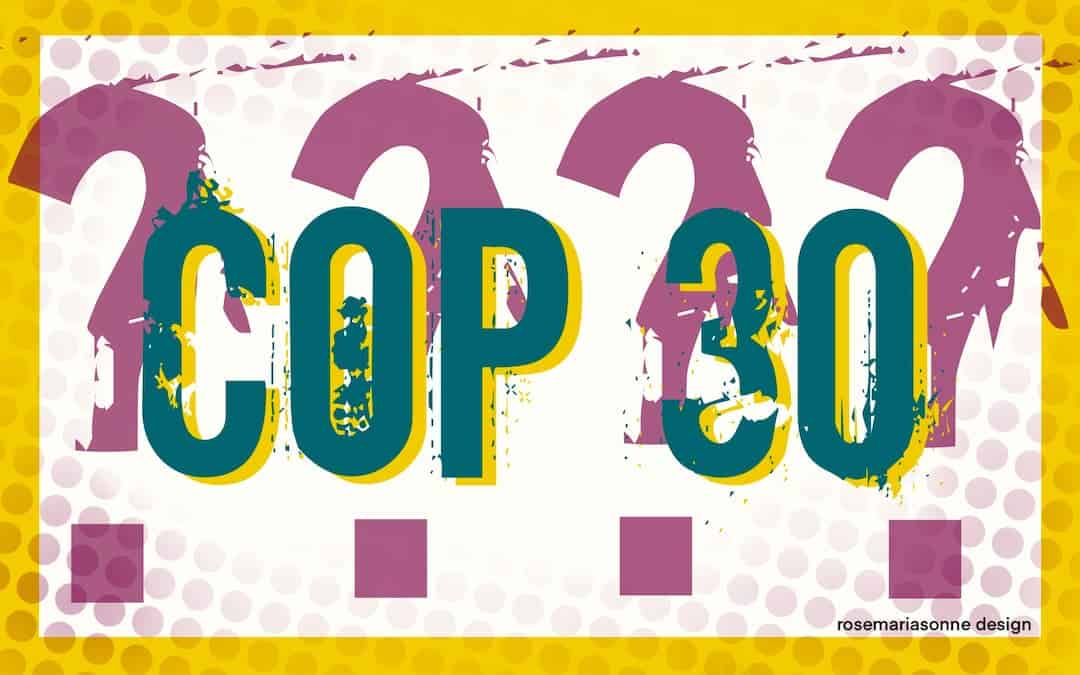
COP 30 – Erfolg oder Scheitern?
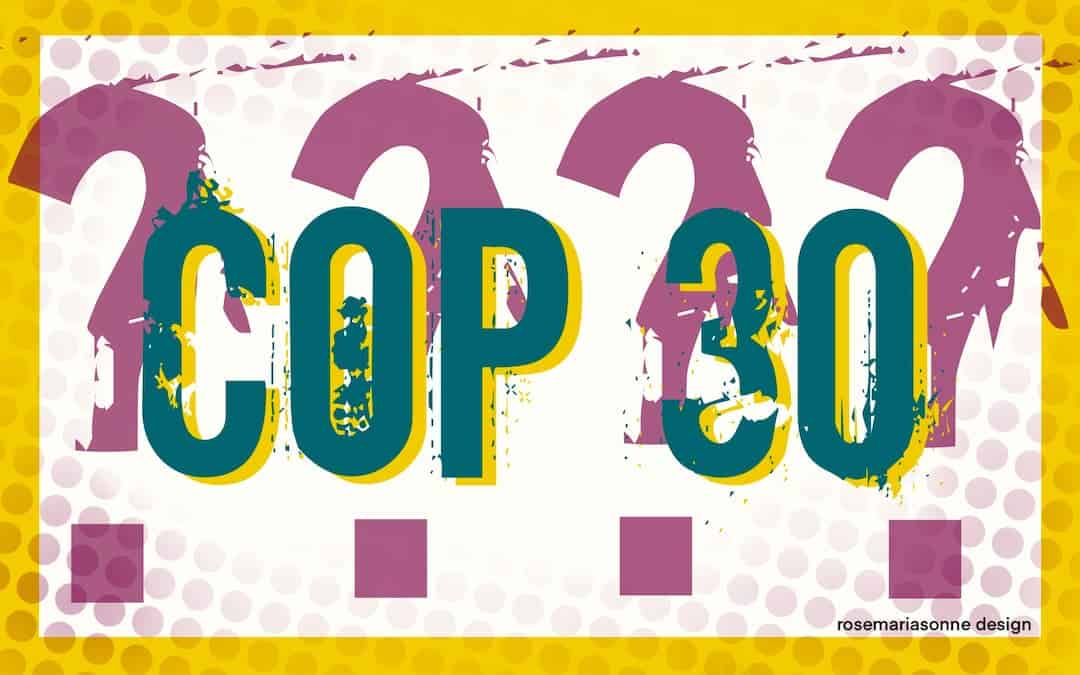
COP 30 – Erfolg oder Scheitern?
von Roland Vossebrecker
Die COP 30 ist Geschichte, Umweltminister Carsten Schneider ist „ein bisschen enttäuscht“…
Wie siehst Du das Resultat dieser Weltklimakonferenz? Kannst Du Fortschritte sehen? Was macht Dir Hoffnung? Was sind Deine Emotionen zum Abschluss und Ergebnis der COP 30?
Schreibe uns in der Kommentarfunktion.
Hier meine ganz persönliche Einschätzung:
Wenn sich die Weltgemeinschaft 10 Jahre nach dem Pariser Abkommen nicht darauf verständigen kann zu bekunden, dass man es damals in Paris ernst gemeint habe, dann ist für mich nicht nur die COP 30, sondern das Format COP als Ganzes gründlich gescheitert.
In schöner Regelmäßigkeit richtet sich nach jeder enttäuschenden Konferenz der hoffnungsvolle Blick auf die nächste, in diesem Fall auf die COP 31 in der Türkei. Ich kann mich diesem Zweckoptimismus nicht mehr anschließen, lasse mich aber gerne positiv überraschen.
Für mich hat die COP 30 einmal mehr gezeigt, dass der notwendige Wandel – wenn er denn überhaupt kommt – nicht von den Regierungen und Staaten ausgehen wird. Er muss von unten kommen, er muss von UNS kommen. Von all jenen, die sich dem fossilen System verweigern, die nicht mehr mitmachen wollen bei Zerstörung und Ausbeutung von Mitwelt und Mitmenschen.
Roland Vossebrecker


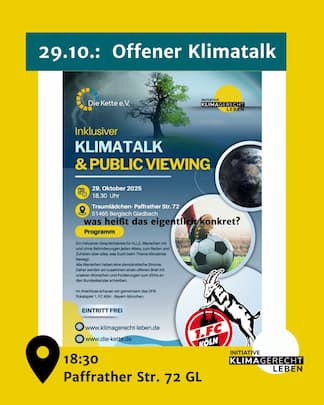



Neueste Kommentare