
Kollektive Verdrängung

Kollektive Verdrängung – „So schlimm wird es doch nicht werden“
Roland Vossebrecker
Ist die Klimakrise im Bewusstsein der breiten Bevölkerung, in der „Mitte der Gesellschaft“, wie man so sagt, angekommen? Ja und Nein:
Im ZDF-Politbarometer vom April 2023 waren 48 % der Befragten der Meinung, es würde zu wenig für den Klimaschutz getan. So weit, so gut, aber im Januar 2024 waren es nur noch 35 %, 22 % hielten die Maßnahmen für gerade richtig, und für atemberaubende 37 % gingen die Maßnahmen zu weit.
Natürlich gibt es sie, die Menschen, die begriffen haben, was auf dem Spiel steht, die sich engagieren, die kämpfen, um das Schlimmste noch zu verhindern. Aber noch mal: Ein sattes Drittel der Deutschen ist der Meinung, es würde zu viel für den Klimaschutz getan!
Dazu kommt, dass gar zu Viele zwar für mehr Klimaschutz sind, aber gegen Maßnahmen, die sie selbst betreffen. Klimaschutz sollen die anderen machen, aber ein Windrad in Sichtweite möchte man dann doch lieber nicht, und kosten soll der Klimaschutz natürlich auch nichts.
Also doch eher nein, auf jeden Fall nicht ausreichend. Und dies trotz jahrzehntealter wissenschaftlicher Erkenntnisse und immer drastischerer Weckrufe:
- Bereits 2019 hatten 11.000 Wissenschaftler*innen gewarnt, wenn sich das menschliche Verhalten, das zu Treibhausgasausstoß und anderen den Klimawandel begünstigenden Faktoren führt, nicht grundlegend und anhaltend verändere, sei „unsägliches menschliches Leid“ nicht mehr zu verhindern.
- UN-Generalsekretär António Guterres sparte auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich nicht mit deutlichen Formulierungen: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal.“ und „Entweder gibt es einen solidarischen Klimavertrag oder einen Vertrag zum kollektiven Selbstmord.“
- Ein internationales Team in den „Proceedings“ der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften („PNAS“) schreibt in ihrer Studie „Klima-Endspiel: Erforschung katastrophaler Szenarien des Klimawandels“, dass dieser im schlimmsten Fall zum Aussterben der Menschheit führen könnte.
Was sind die Ursachen dieser kollektiven Verdrängungsleistung? Aus welchen Gründen machen sich viele Menschen mehr Sorgen um ihren Mallorca-Urlaub als um eine eskalierende Klimakrise? Wieso haben viele mehr Angst vor Klimaschutz als vor der heraufziehenden Klimakatastrophe? Wieso leben die meisten Menschen ihr Leben mehr oder weniger unbeeindruckt von den wissenschaftlichen Warnungen weiter wie bisher?
Eine einfache Antwort kann es nicht geben und Ursachen für menschliches Verhalten sind immer vielfältig.
Die Lobby
Die fossile Lobby war nicht untätig. Seit Jahrzehnten werden Desinformationen gestreut und Zweifel am menschengemachten Klimawandel gesät. Als sich dieser nicht mehr leugnen ließ, ging man dazu über, die Verantwortung den „Verbraucher*innen“ in die Schuhe zu schieben und gleichzeitig mit verführerischen Greenwashing-Angeboten die Kundschaft einzulullen. Die Werbung trägt ihren Teil dazu bei: „Rette die Meere mit Shampoo!“
Die Gesellschaft
Menschen orientieren sich an anderen, an ihrem sozialen Umfeld, an gesellschaftlichen Normen. Selbst in offensichtlichen Notsituationen reagieren die meisten nicht, wenn auch andere die Warnzeichen ignorieren. Das haben sozial-psychologische Studien gezeigt. (So z. B. in der sogenannten „Rauchstudie“, bei der nur 10 % der Probanden Alarm schlagen, wenn Rauch ins Zimmer strömt, aber andere Anwesende nicht darauf reagieren.)
Mit unserer gelebten „Normalität“ bestätigen wir uns gegenseitig täglich, dass uns die Klimakrise nicht betrifft.
Die Politik
Dramatisch verschärft wird dieser Effekt dadurch, dass die Weckrufe keinen Widerhall in politischem Handeln haben. Die Warnung vor einem möglichen Aussterben der Menschheit sollte doch eigentlich Anlass genug für einen Krisengipfel sein, aber ein solcher ist nicht in Sicht. Reaktionen der politischen Akteur*innen bleiben regelmäßig aus, und die alljährlichen Weltklimakonferenzen können mit ihrer routinierten Ergebnislosigkeit beim besten Willen nicht als Krisengipfel wahrgenommen werden.
Wenn dann auch noch prominente Politiker*innen allen wissenschaftlichen Warnungen und Erkenntnissen ausdrücklich widersprechen (Friedrich Merz: „Es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Wenn wir in den nächsten zehn Jahren die Weichen richtig stellen, sind wir auf einem guten Weg“), dann muss nicht mehr verwundern, dass der Eindruck entsteht, es sei ja alles doch gar nicht so schlimm.
Die Medien
Eine besondere Verantwortung kommt auch den Medien zu. Eine falschverstandene „Meinungsvielfalt“, das Nebeneinander von populistischen Falschbehauptungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen trägt massiv zur Verunsicherung bei.
„Jede*r hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten.“
Eckart von Hirschhausen (und viele andere)
Es ist nicht lange her (Mai 2023), da musste der Klimaforscher Mojib Latif bei Markus Lanz das verlogene Geschwätz eines AfD-Menschen ertragen. Warum gibt man solchen Leuten eine Bühne für ihre Lügen?
https://weact.campact.de/petitions/keine-buhne-fur-nazi-propaganda-im-orr
Das Argument, ein gestandener Wissenschaftler wie Latif müsse solche Unwahrheiten doch leicht entkräften können, zieht leider nicht: Wer Lügen glauben will, der glaubt sie eben! Die rechten Populisten wissen sehr genau, wie verführerisch ihre Lügen sind. Eine Welt ohne Klimawandel wäre ja viel bequemer und sorgenfreier, und so müssen auch die eigenen Privilegien nicht hinterfragt werden. Das Verständnis für wissenschaftliches Denken und das Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse werden so systematisch diskreditiert.
Markus Lanz schlug in dieselbe Kerbe, als er im Gespräch mit Carla Rochel („Letzte Generation“) die unsägliche Frage formulierte: „Aber woher weiß die Wissenschaft das?“. Verantwortungsvoller Journalismus geht anders! Ganz anders!
Auch an anderer Stelle werden die Medien vielfach ihrer Verantwortung nicht gerecht.
„Die Medien haben es versäumt, diejenigen, die für die Zerstörung unserer Biosphäre verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen, und agierten praktisch als Wächter des Status quo. Angesichts der Größe unserer Mission und der Zeit, die uns zum Handeln bleibt, gibt es ehrlich gesagt keine andere Instanz als die Medien, die die Möglichkeit hat, die notwendige Transformation unserer globalen Gesellschaft herbeizuführen. Damit dies geschieht, müssen sie beginnen, die Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitskrise wie die existenzielle Krise zu behandeln, die sie ist. Es muss die Nachrichten dominieren.“
Greta Thunberg, The Climate Book
Es muss die Nachrichten dominieren! Aber das passiert (noch) nicht.
Natürlich wird über die sich häufenden Klimakatastrophen und über die unzähligen Weckrufe der Wissenschaft berichtet. Im Hitzesommer 2023 mit weltweiten Rekordtemperaturen, Waldbränden und Überschwemmungen sind die Nachrichten voll davon. Aber die Dramatik solcher Meldungen verpufft augenblicklich, wenn unmittelbar danach Elon Musks Ego-Trip seiner SpaceX-Riesenrakete gefeiert und das Ausscheiden des FC Bayern München aus der Champions League als die eigentliche nationale Katastrophe beklagt wird.
Es fehlen die Kontexte, die Zusammenhänge, die Konsequenzen. Wer würde es wagen, nach einer Formel-1-Berichterstattung auf die verheerende CO2-Bilanz einer solchen Veranstaltung hinzuweisen? Selbst neben hervorragenden Artikeln zur Klimathematik finden sich immer wieder Werbeanzeigen für Kreuzfahrten oder SUVs. So werden die Botschaften, die Appelle, die Warnungen auf schnellstem Wege neutralisiert.
Während ich diese Zeilen schreibe, werden Tourist*innen von der griechischen Insel Rhodos evakuiert und vor den Bränden in Sicherheit gebracht. Gleichzeitig landen weitere Ferienflieger auf Rhodos. Wer würde den Hinweis wagen, dass es in Zeiten einer eskalierenden Klimakrise keine so gute Idee ist, in den Urlaub zu fliegen und damit die Krise weiter anzuheizen?
Nun wird medial diskutiert, ob 2050 noch jemand am Mittelmeer Urlaub machen wird. Da heißt es, dass der italienischen Tourismusbranche Einbußen von 52 Milliarden Euro drohen – wenn die Durchschnittstemperatur um 4° Grad ansteigt. Was für ein falscher Fokus! Warum wird nicht vermittelt, dass es bei vier Grad nicht mehr um den Urlaub, sondern ums Überleben geht?
Nötig wäre es…
Unsere Aufgabe
Wie also können wir Menschen erreichen, aufwecken, überzeugen?
Klima-Kommunikation ist eine schwierige Angelegenheit. Meiner Überzeugung nach braucht sie, neben Geduld und Fingerspitzengefühl, im Wesentlichen drei Schritte:
- Die drohende Gefahr klar benennen. Was steht auf dem Spiel?
- Verantwortlichkeiten und Handlungsspielräume aufzeigen. Welchen Beitrag kann/muss ich leisten?
- Eine positive Vision. Was können wir gewinnen?
Roland Vossebrecker
P. S. Eine sehr positive Initiative (unter vielen) ist das Netzwerk Klimajournalismus.
Es gibt Journalist*innen das notwendige Knowhow an die Hand, um kompetenter, umfassender und seriöser über die Klimakrise berichten zu können.


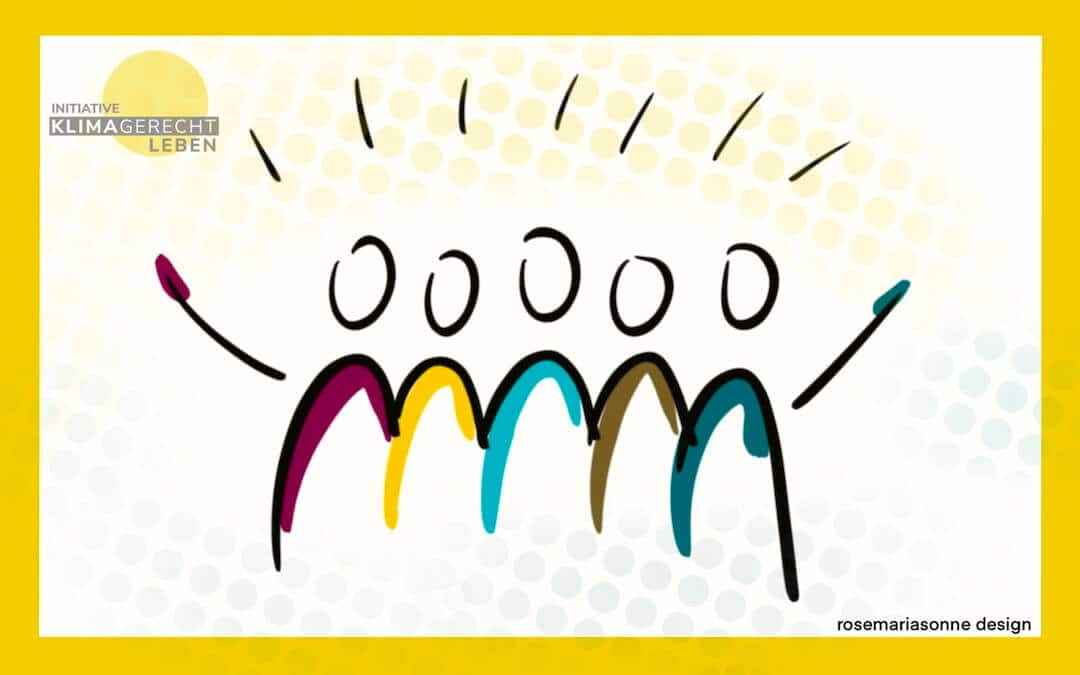
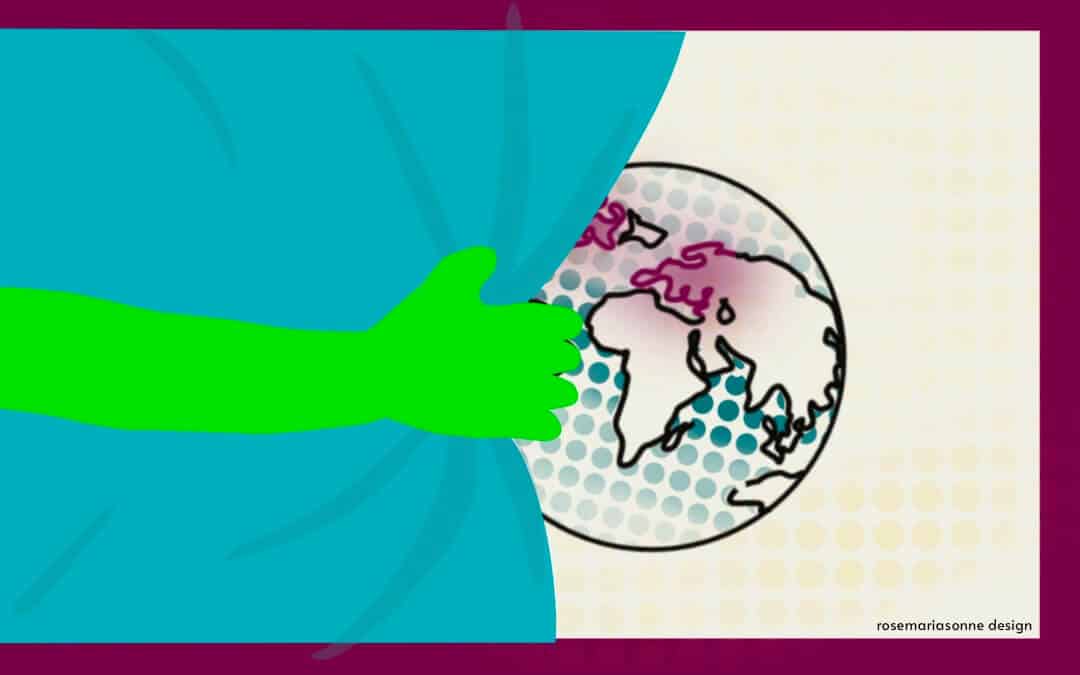


Neueste Kommentare